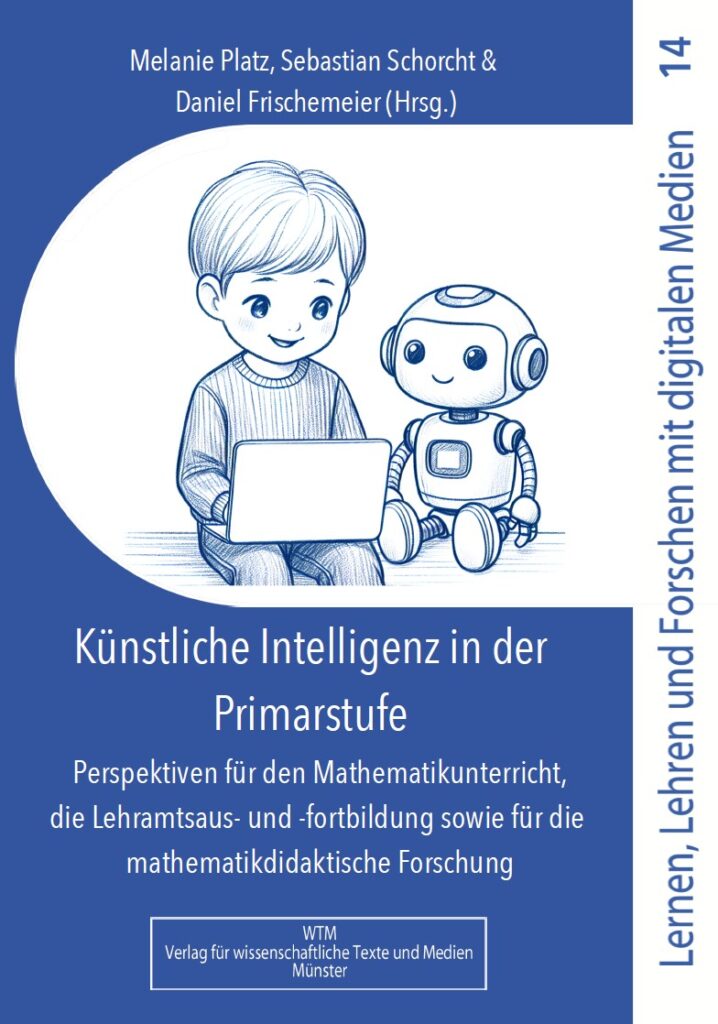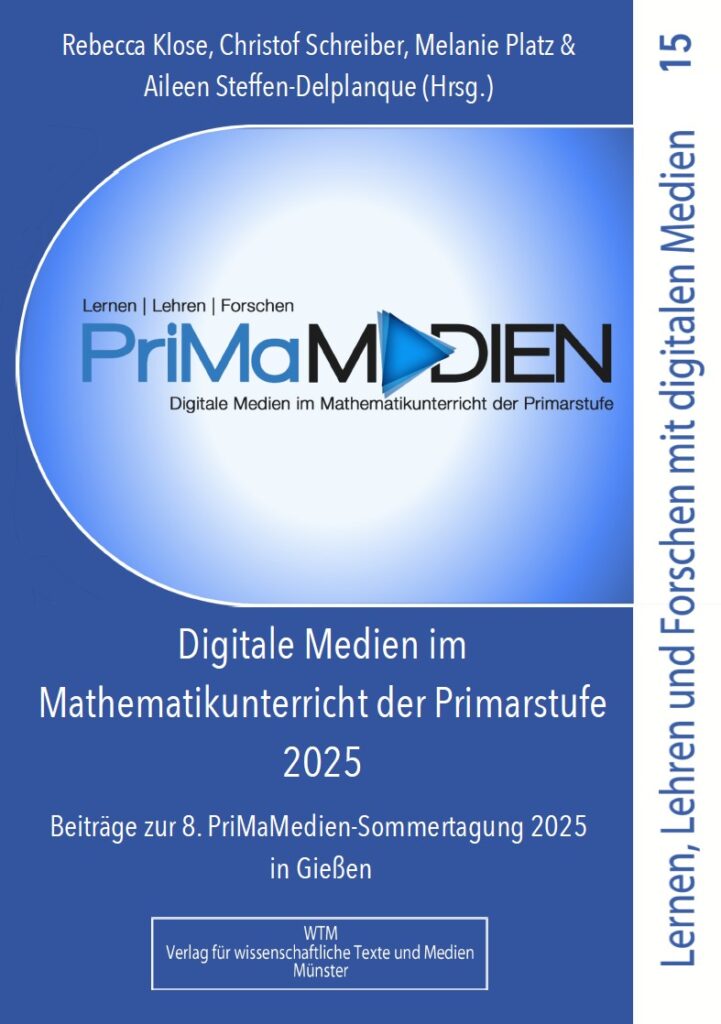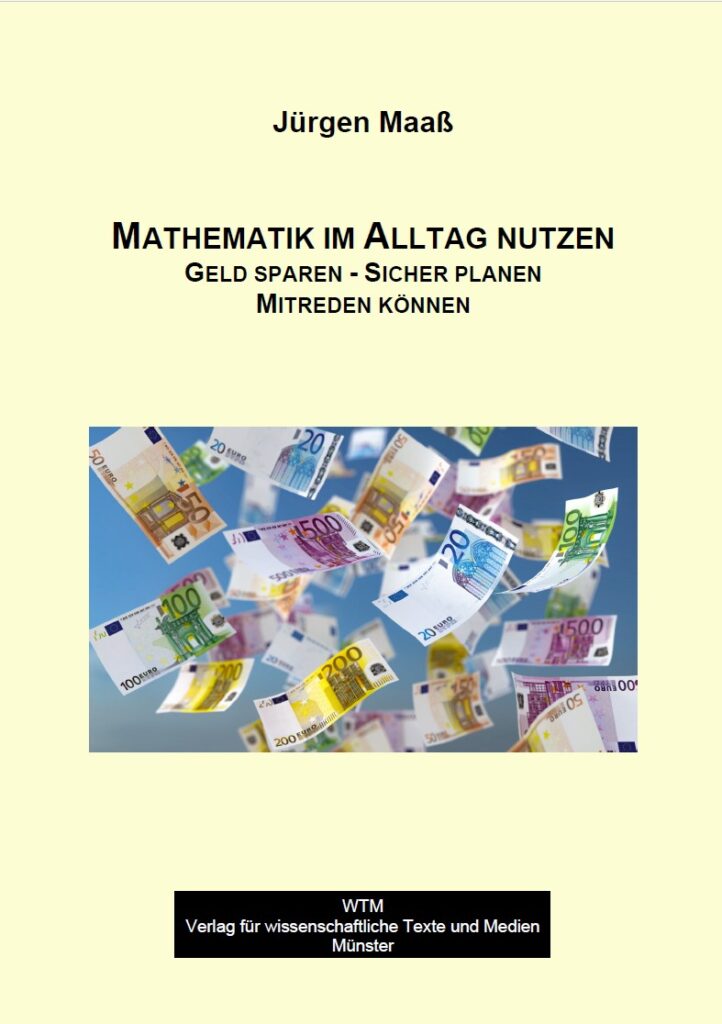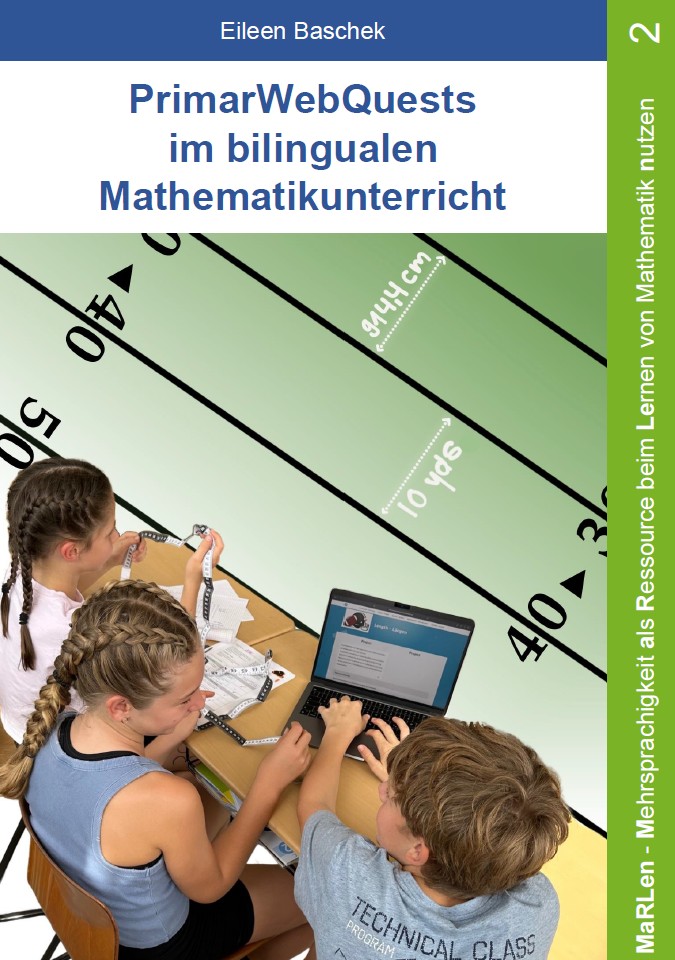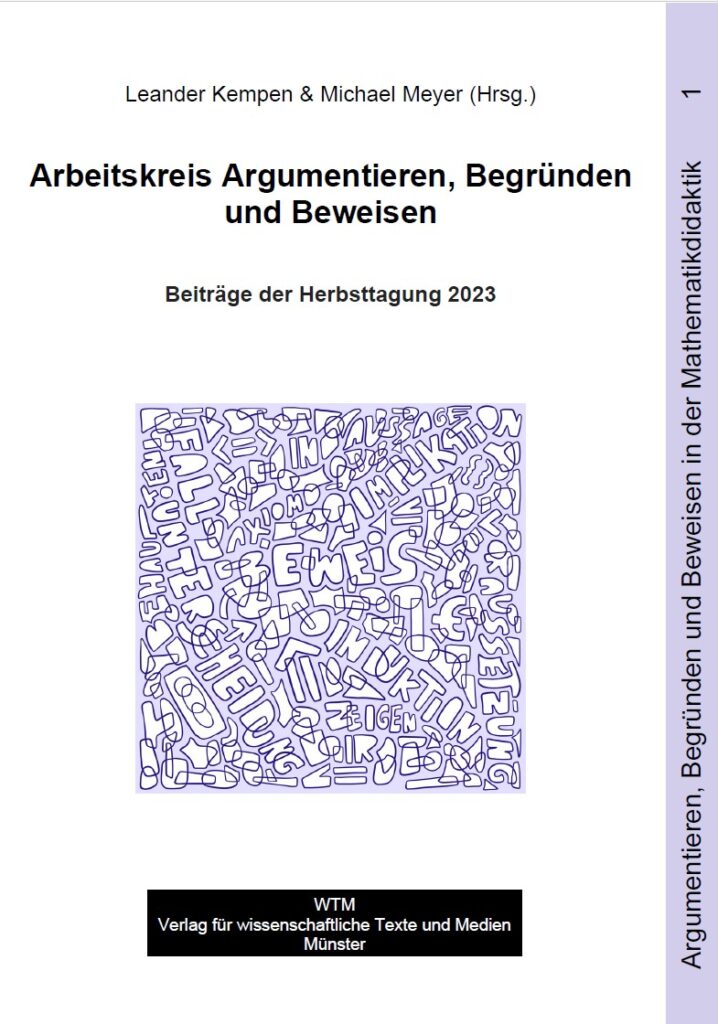Tagungsband der Herbsttagung des GDM-Arbeitskreises Problemlösen in Braunschweig 2016
Tagungsband der Herbsttagung des GDM-Arbeitskreises Problemlösen in Braunschweig 2016
Münster: WTM-Verlag 2017. Ca. 180 Seiten, DIN A5.
978-3-95987-061-0 print 24,90 € / 978-3-95987-062-7 E-Book 22,90 €
https://doi.org/10.37626/GA9783959870627.0
Für Bestellungen bei edition-buchshop hier klicken
Bestellungen direkt an kontakt@wtm-verlag.de
Das (mathematische) Problemlösen ist und bleibt ein hochaktuelles Thema der Bildungswissenschaften, der Psychologie und – nicht zuletzt – der Fachdidaktik (Mathematik). Es ist allgemeiner Konsens, dass das Problemlösen zu den Schlüsselkompetenzen gehört, die von Lernenden in allen Jahrgangsstufen der Schulausbildung und im Studium erworben werden sollten. Ebenfalls unumstritten ist, dass insbesondere die Mathematikausbildung einen wichtigen Beitrag hierzu leisten kann. Aber wie kann dies erfolgen?
Unter dem Motto „Mathematische Problemlösekompetenzen fördern“ fand am 14. und 15.10.2016 an der TU Braunschweig die dritte Herbsttagung des Arbeitskreises Problemlösen der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik statt.
Die beiden Hauptaktivitäten der Tagung, in denen Maßnahmen und Projekte zur Förderung der Problemlösekompetenz vorgestellt und diskutiert wurden, waren ein Vortrag von Harald Schaub aus der psychologischen und ein Workshop aus der mathematikdidaktischen Perspektive. Die zugehörigen Beiträge im vorliegenden Buch bieten einen guten Überblick über den derzeitigen Stand der deutschsprachigen Problemlöseforschung.
Des Weiteren fanden neun Präsentationen – vorwiegend von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern – zu verschiedenen Aspekten des Lernens und Lehrens über, von und durch Problemlösen statt. Die zugehörigen Ausarbeitungen in diesem Band bieten einen Blick in brandaktuelle Forschung und wichtige (Zwischen-) Ergebnisse laufender Forschungsprojekte.
Heinrich, Frank: Geleitwort und Danksagung. pp 3 – 4
https://doi.org/10.37626/GA9783959870627.0.01
Schaub, Harald: 60 Jahre Forschung zum Problemlösen – Kompetenz für das Handeln und Entscheiden in soziotechnischen Systemen. pp 5 – 30
https://doi.org/10.37626/GA9783959870627.0.02
Rott, Benjamin; Kuzle, Ana: Maßnahmen zur Förderung der Problemlösekompetenz – die mathematikdidaktische Perspektive. pp 31 – 54
Nicht nur in der Psychologie, sondern auch in der Mathematikdidaktik wurden und werden Konzepte und Maßnahmen zur Förderung der Problemlösekompetenz entwickelt. Teilweise richten sich diese direkt an die Lernen-den, teilweise werden Lehrende geschult, um ihrerseits dann die Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern zu fördern.
In einem Workshop während der Tagung wurden Fördermaßnahmen zusammengetragen, verglichen und kritisch diskutiert. Dabei wurden insbesondere die folgenden beiden Fragen angesprochen: (1) Welche (Teil-) Konzepte bzw. Maßnahmen haben sich als erfolgreich erwiesen und wie? (2) An welchen Stellen eröffnen sich Verbesserungspotentiale?
Ziele des Workshops waren die Entwicklung gemeinsamer Konzeptideen und das Anbahnen von Kooperationen (im Rahmen des Arbeitskreises Problem-lösen und darüber hinaus) zu ihrer Umsetzung. Dieser Beitrag verfolgt zusätzlich das Ziel, die vorgestellten Projekte mithilfe eines Rasters zu sortieren, um einen Vergleich auf verschiedenen Ebenen zu erleichtern.
https://doi.org/10.37626/GA9783959870627.0.03
Beyerl, Maria; Fritz, Julia: Ausgewählte Maßnahmen zur Förderung der Problemlösekompetenz. pp 55 – 84
Die Entwicklung der Problemlösekompetenz gilt seit den 70er Jahren als ein wesentliches Ziel von Mathematikunterricht. Doch wie lässt sich diese Forderung, die an den Mathematikunterricht gestellt wird, in der Schule umsetzen? Eine Untersuchung zum Problemlöseunterricht soll Aufschluss darüber geben, wie Lehrpersonen den Problemlöseprozess der Lernenden begleiten, wie sie mit Schwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler umgehen und inwiefern sie Unterstützungsmaßnahmen bei der Problembearbeitung einsetzen. Ein Schwerpunkt dieser Erkundungsstudie liegt darauf, zu untersuchen, in welcher Form der Aspekt “Fehler” im Problemlöseunterricht auftritt und welche Methoden die Lehrkraft im Umgang mit Fehlersituationen einsetzt. Ferner werden im Rahmen dieses Projektes Wechselsituationen von Lösungsanläufen analysiert. In diesem Zusammenhang gilt es, den (didaktischen und methodischen) Umgang der Lehrkraft mit dem Aspekt “Wechsel von Lösungsanläufen” zu erkunden.
https://doi.org/10.37626/GA9783959870627.0.04
Gawlick, Thomas: Analyse von Problemlöseprozessen mit Tempelbildern und Barrierebänden. pp 85 – 100
Zwei Werkzeuge zur Analyse von Problemlöseprozessen hinsichtlich des Umgangs mit Barrieren und des Lösungserfolgs werden anhand von Beispielprozessen erläutert und mit anderen Analyseinstrumenten verglichen.
https://doi.org/10.37626/GA9783959870627.0.05
Herold-Blasius, Raja; Rott, Benjamin: Welchen Einfluss haben Strategieschlüssel aus Problemlöseprozesse? – Methodische Überlegungen zur Analyse. pp 101 – 118
Strategieschlüssel können als Impulse und Anregungen (sogenannte Prompts) in Problemlöseprozessen eingesetzt werden. Sie sollen Schülerinnen und Schülern helfen, Hürden im Bearbeitungsprozess zu überwinden. Um zu untersuchen, welchen Einfluss die Strategieschlüssel auf Problembe-arbeitungsprozesse18 von Lernenden haben, wurden insgesamt 41 Bearbeitungsprozesse von Dritt- und Viertklässlern videografiert. Zur Analyse wer-den drei verschiedene Kodierungen herangezogen: (a) die Kodierung von Phasen im Problembearbeitungsprozess mithilfe der sogenannten Schoenfeld-Episoden, (b) die Kodierung der Heurismen und (c) die Kodierung von Prompts. Auf diese Art und Weise soll der Einfluss der Strategieschlüssel auf Problembearbeitungsprozesse erfasst und ganzheitlich verstanden werden. In diesem Beitrag wird insbesondere die Prompt-Kodierung beschrieben und diskutiert. Weiter werden erste Ergebnisse aus den bisherigen Analysen und dem Zusammenspiel der drei Kodierungen aufgezeigt.
https://doi.org/10.37626/GA9783959870627.0.06
Joklitschke, Julia; Rott, Benjamin; Schindler, Maike: Zu Konzeptualisierungen mathematischer Kreativität sowie möglichen Studiendesigns. pp 119 – 134
Kreativität und mathematische Kreativität werden in der Forschung auf verschiedenste Weise konzeptualisiert – mit Auswirkungen auf Studiendesigns und Forschungsergebnisse. Der Beitrag stellt unterschiedliche Grundannahmen und Konzeptualisierungen von (mathematischer) Kreativität vor, systematisiert diese und leitet Konsequenzen für Studiendesigns empirischer Studien ab.
https://doi.org/10.37626/GA9783959870627.0.07
Ohlendorf, Meike: Zur Phase Rückschau im Problemlöseunterricht. pp 135 – 150
Der Phase Rückschau im Anschluss an die Problemlösebemühungen wird in der Theorie (z. B. bei Pólya, Schoenfeld oder Mason, Burton und Stacey) eine große Bedeutung beigemessen. In der hier vorgestellten empirischen Erkundungsstudie in den Jahrgangsstufen 9 und 10 zeigt sich, dass eine solche Reflexion im gegenwärtigen Problemlöseunterricht eher vernachlässigt wird. Entsprechende erste Befunde einer empirischen Erkundungsstudie aus den Jahrgangsstufen 9 und 10 werden vorgestellt und diskutiert. Dabei soll untersucht werden, wie die Phase Rückschau von Lehrern unterrichtlich gestaltet wird. In der Auswertung von 14 Doppelstunden sollen wichtige Komponenten des Lehrerhandelns während unterrichtlicher Rückschauen erfasst werden.
https://doi.org/10.37626/GA9783959870627.0.08
Söhling, Anna-Christin: Zum Zusammenhang zwischen Abduktion und psychologischen Problemlösetheorien. pp 151 – 166
Der Begriff der Abduktion wurde im Dissertationsprojekt der Autorin dazu genutzt, mathematische Problemlöseprozesse von SchülerInnen zu analysieren. Im Folgenden soll der Zusammenhang zwischen dem Abduktionsbegriff und ausgewählten psychologischen Theorien untersucht werden. Einerseits wird danach gefragt, welchen Nutzen der Abduktionsbegriff in der Mathematikdidaktik haben kann, der über den Nutzen von psychologischen Theorien hinausgeht. Hierbei scheint der Abduktionsbegriff durch seine starke inhaltliche Orientierung vor allem die Besonderheiten des mathematischen Problemlösens beleuchten zu können. Andererseits wird der Frage nachgegangen, wie die Abduktionsanalyse mithilfe von psychologischen Begriffen sinnvoll erweitert werden kann.
https://doi.org/10.37626/GA9783959870627.0.09
Stenzel, Thomas: Problemlösen und Beweisen im Mathematikstudium – eine Kategorisierung von Aufgaben der Analysis I. pp 167 – 183
Viele Studienanfänger der Mathematik (B. Sc. und Gymnasiallehramt) haben Schwierigkeiten bei der Bearbeitung komplexerer Aufgaben. In der vor-liegenden Studie wurden Übungsaufgaben zur Analysis I kategorisiert und qualitativ auf mögliche Lösungsstrategien untersucht. Im Vergleich zu an-deren Problemen haben Beweise eine herausstechende Eigenschaft: Das Ziel ist bereits in der Aufgabenstellung klar formuliert („Zeigen Sie, dass…“). Das erleichtert den Zugriff über Strategien des Rückwärtsarbeitens.
https://doi.org/10.37626/GA9783959870627.0.10