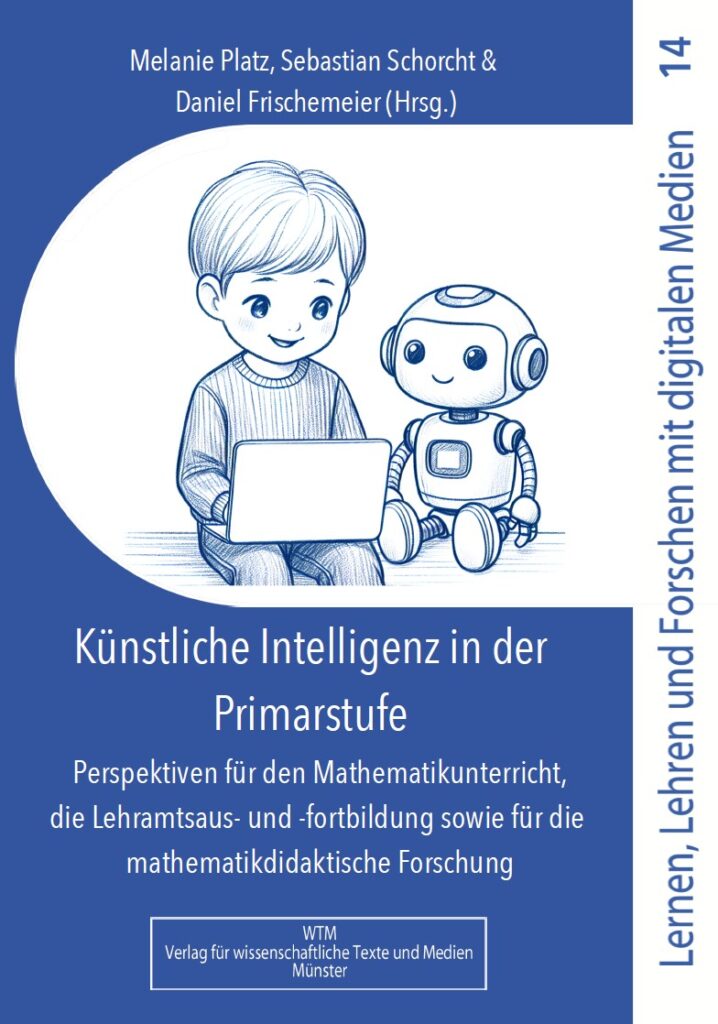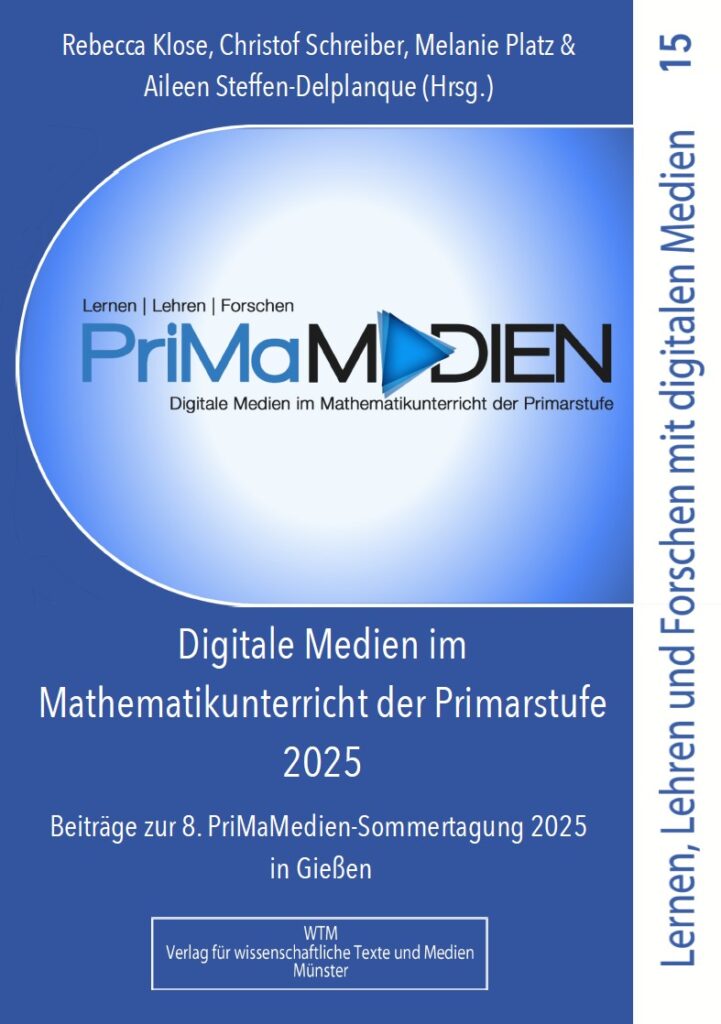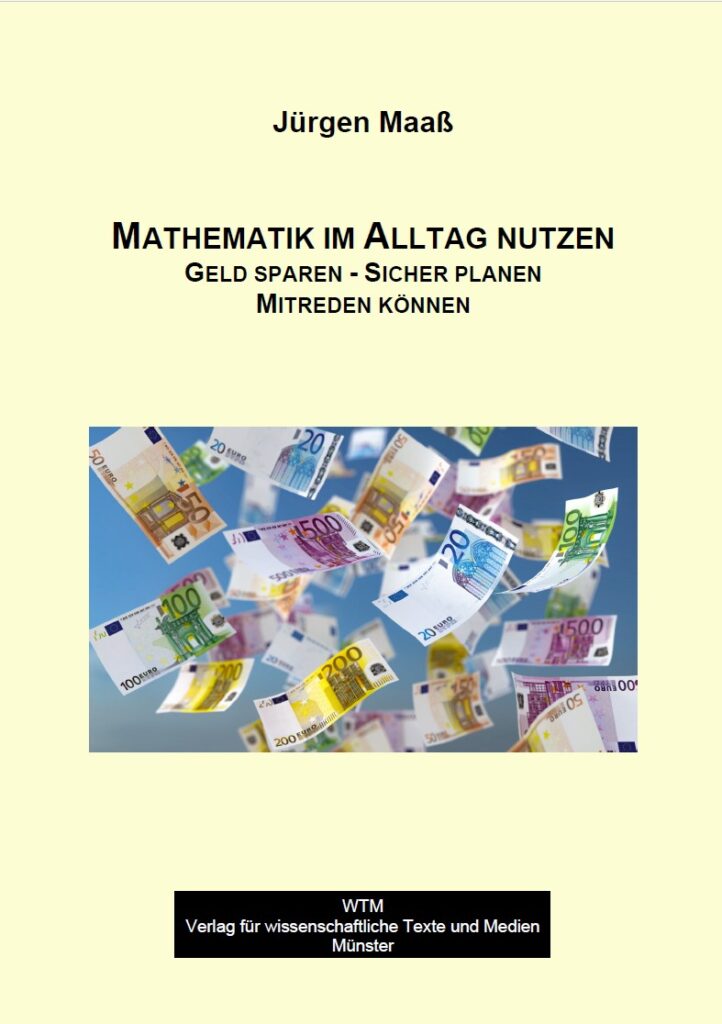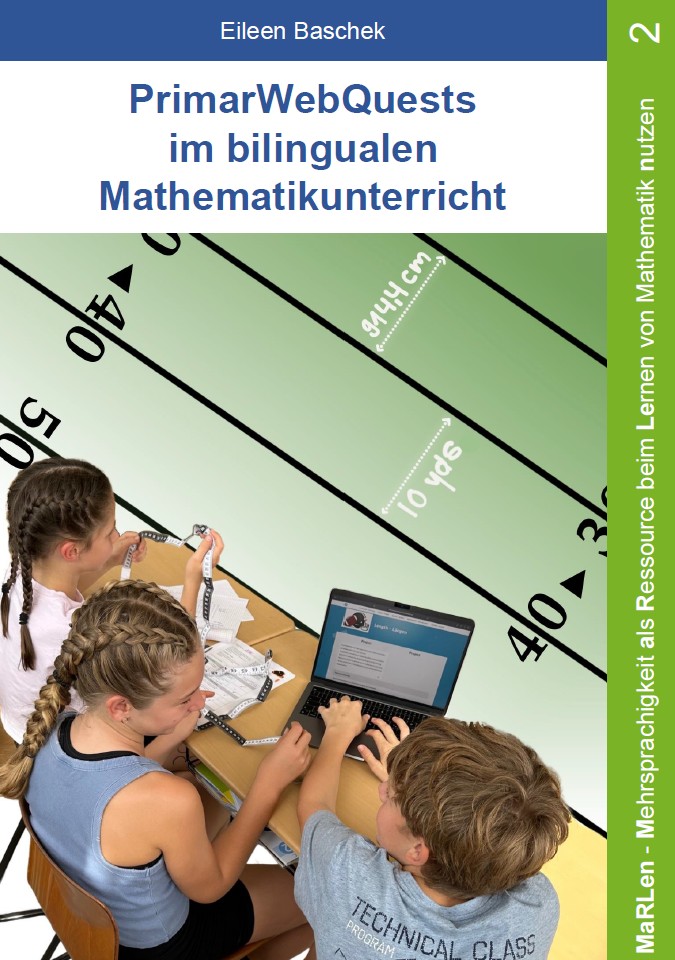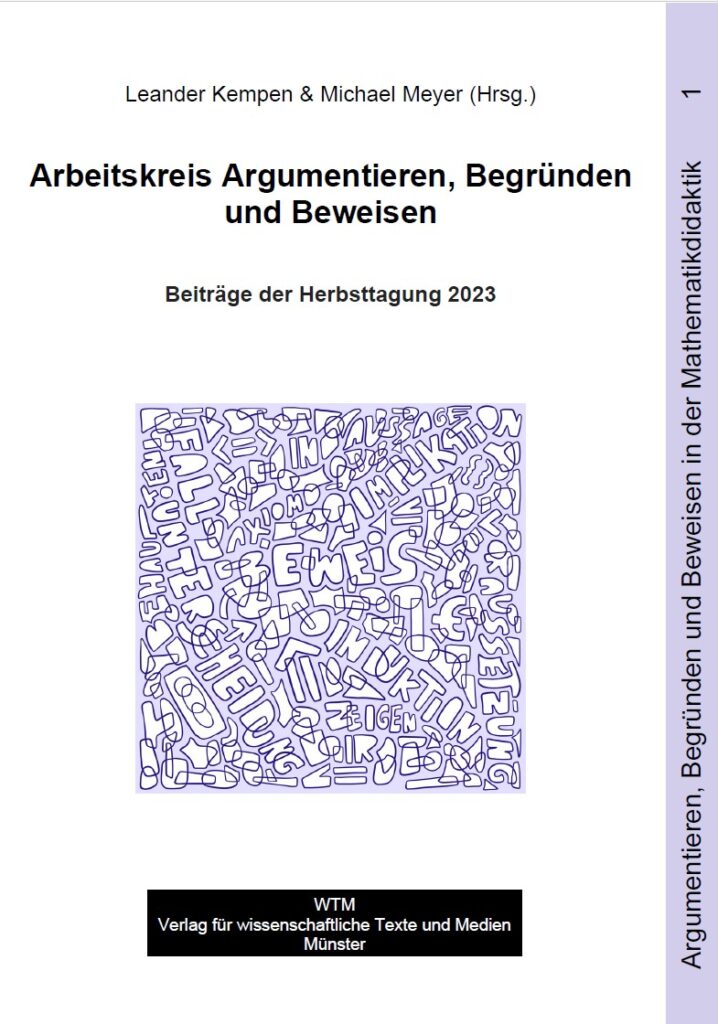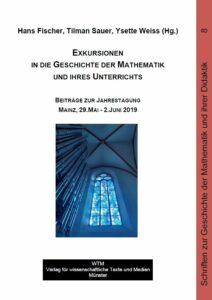 Beiträge zur Gemeinsamen Jahrestagung 2019 der Fachsektion der DMV Mathematikgeschichte” und des Arbeitskreises der GDM “Mathematikgeschichte und Unterricht”
Beiträge zur Gemeinsamen Jahrestagung 2019 der Fachsektion der DMV Mathematikgeschichte” und des Arbeitskreises der GDM “Mathematikgeschichte und Unterricht”
Münster: WTM-Verlag 2021
Ca. 375 S., DIN A5
978-3-95987-185-3 – Print 38,90 €
978-3-95987-186-0- E-Book 35,90 €
https://doi.org/10.37626/GA9783959871860.0
Für Bestellungen bei edition-buchshop hier klicken
Abstract
Mathematikgeschichte verbindet Mathematik, Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften. Die Entwicklung der Mathematik ist immer auch eine Veränderung einer gesellschaftlichen Praxis, Mathematik zu betreiben und diese durch stabile Formen wie Institutionen, mathematische Werkzeuge und mathematische Sprache zu etablieren.
Besonders die jüngere Geschichte der Vermittlung von Mathematik in Schule und Universität
baut weitere Brücken zu Themen, die in der Psychologie, den Sozial- und Politikwissenschaften angesiedelt sind.
Die integrative Sicht auf Geschichte der Mathematik prägt die gemeinsamen, im zweijährigen Turnus stattfindenden Tagungen der Fachsektion Geschichte der Mathematik der DMV und des Arbeitskreises Mathematikgeschichte und Unterricht der GDM.
Dieser Tagungsband zur Mainzer Tagung, welche vom 29. Mai bis 2. Juni 2019 im Erbacher Hof stattfand, zeigt den fachübergreifenden und durch Perspektivenvielfalt geprägten Charakter dieser Tagungsreihe.
Das gemeinsame Anliegen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Vorstellungen von einer oft als unveränderlich und fertig wahrgenommenen Wissenschaft Mathematik zu bereichern und zu erweitern, wird in dem vorliegenden Band auf mannigfaltige Art verwirklicht.
BEITRÄGE
Verfasser*innen: Bernd Kirstein
Titel des Beitrags: Hans-Joachim Girlich (1938-2018)
Erste Seite: 3
Letzte Seite: 13
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959871860.0.01
Verfasser*innen: Harald Boehme
Titel des Beitrags: Eine Rekonstruktion des Beweises von Theodoros
Erste Seite: 17
Letzte Seite: 28
Abstract
In Platons Dialog Theaitetos diskutieren Sokrates, Theodoros von Kyrene und Theaitetos über die Frage „Was ist Erkenntnis?“ Als ein Beispiel erzählt Theaitetos, dass Theodoros für die nichtquadratischen Zahlen und einer gegebenen Strecke gezeigt hat, dass die Strecke nicht kommensurabel zu ist. Auf Grund der Beweise für jede einzelne dieser Zahlen erkannte Theaitetos, dass die Beweise quasi allgemein sind; darauf hin definierte er die Strecken als dynameis, weil sie für alle nichtquadratischen Zahlen nicht kommensurabel zu sind, aber in der Potenz mit den Flächen [Tht. 148 a-b]. In meinem Beitrag wird zunächst eine Rekonstruktion der einzelnen Beweise des Theodoros vorgestellt, so dass auf einen allgemeinen Beweis des Theorems geschlossen werden kann. Dieser beruht jeweils auf einer absteigenden Rekursion von Zahlenpaaren, die für invertierbar ist; damit ergeben sich aufsteigende Rekursionen dieser Zahlenpaare als Verallgemeinerungen der Seiten- und Diagonalzahlen des Quadrates.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959871860.0.02
Verfasser*innen: Paul Siebert
Titel des Beitrags: Theons Leiter. Geometrische Deutungen und Verallgemeinerung
Erste Seite: 29
Letzte Seite: 38
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959871860.0.03
Verfasser*innen: Jacques Sesiano
Titel des Beitrags: Frühgeschichte der magischen Quadrate
Erste Seite: 41
Letzte Seite: 49
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959871860.0.04
Verfasser*innen: Magdalena Hykšová
Titel des Beitrags: Wahrscheinlichkeit im Mittelalter
Erste Seite: 50
Letzte Seite: 62
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959871860.0.05
Verfasser*innen: Philip Beeley
Titel des Beitrags: Die frühneuzeitliche Rezeption der Elemente der Geometrie am Beispiel einiger zeitgenössischer Editionen
Erste Seite: 65
Letzte Seite: 83
Abstract
In der Anzahl der Drucke werden die Elemente der Geometrie Euklids in der frühen Neuzeit nur noch von der Bibel übertroffen – etwa dreihundert verschiedene Ausgaben sind schon bis Ende des 17. Jahrhunderts verzeichnet. Im Aufsatz werden neun ausgewählte Editionen der Elemente, die zwischen 1655 und 1756 auf Deutsch, Englisch, Französisch und Latein erschienen sind, untersucht. Dabei stehen vor allem die erklärte Zielsetzung des jeweiligen Herausgebers und die darausfolgenden editorischen Besonderheiten, wie etwa Angaben über die praktische Anwendung von Propositionen, oder die gezielte Straffung des Inhalts im Vordergrund. Auch unterschiedliche Ansätze zum systematischen Aufbau der Elemente werden exemplarisch erfasst und beschrieben. Auf diese Weise wird versucht, anhand einer verhältnissmaßig kleinen Anzahl von Editionen einiges von der enormen Reichhaltigkeit der Euklidschen Tradition in Europa bis in das 18. Jahrhundert hinein zu vermitteln.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959871860.0.06
Verfasser*innen: Lea Dasenbrock
Titel des Beitrags: Frühe Algebralehre an der Universität Wittenberg
Erste Seite: 84
Letzte Seite: 95
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959871860.0.07
Verfasser*innen: Anna-Katharina Pnischek
Titel des Beitrags: Der Begriff der „Progression“ in Michael Stifels Arithmetica integra
Erste Seite: 96
Letzte Seite: 107
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959871860.0.08
Verfasser*innen: Stefan Deschauer
Titel des Beitrags: Eine historische Modellierungsaufgabe im Rechenbuch von Symon Hübner aus Thorn in Preußen
Erste Seite: 108
Letzte Seite: 117
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959871860.0.09
Verfasser*innen: Jennifer Heitholt und Tilman Sauer
Titel des Beitrags: Jakob Köbels Feldmessung: Elementare Fehler oder strategische Vereinfachungen?
Erste Seite: 118
Letzte Seite: 126
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959871860.0.10
Verfasser*innen: Sara Confalonieri
Titel des Beitrags: Die Vorzeichenregel von Descartes: „ … und wir können wissen, wie viele echte Wurzeln und wie viele falsche Wurzeln in jeder Gleichung sind“
Erste Seite: 129
Letzte Seite: 139
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959871860.0.11
Verfasser*innen: Regina Stuber
Titel des Beitrags: Probleme und Fragestellungen bei der Neu-Edition der Cogitationes privatae von Descartes in der Leibniz-Ausgabe
Erste Seite: 140
Letzte Seite: 149
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959871860.0.12
Verfasser*innen: Alfred Holl und Yvonne Stry
Titel des Beitrags: Edition der Grossen Aritmetic von Anton Neudörffer (1571–1628) nach einer Handschrift von Georg Wendler (1619-1688): Transkriptionsprinzipien und Lösungskommentare
Erste Seite: 150
Letzte Seite: 160
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959871860.0.13
Verfasser*innen: Siegmund Probst und Achim Trunk
Titel des Beitrags: Ansätze für eine universelle Behandlung der Kegelschnitte bei Leibniz (1673–1676)
Erste Seite: 161
Letzte Seite: 171
Abstract
One of the central concepts of the philosophy and also of the mathematics of Leibniz was harmony, serving as an expression for the connection of a multiplicity to a unity. In 1674, when he tried to treat the conic sections in analytic geometry without recourse to spatial perception, he spoke of reducing the various curves to a certain harmony. To this end, he had gradually developed a general equation for all conic sections. The equation contained coefficients that could be chosen as finite, infinitely small or infinitely large, and ambiguous signs (undecided whether positive or negative). It formed the prime example of his Méthode de l’universalité, with which he summarized case distinctions through a calculus employing ambiguous signs.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959871860.0.14
Verfasser*innen: Harald Gropp
Titel des Beitrags: Georg Forster (1754–1794) zwischen Cook und A. von Humboldt
Erste Seite: 175
Letzte Seite: 183
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959871860.0.15
Verfasser*innen: Antonio Moretto
Titel des Beitrags: Der Königsberger Philosoph Martin Knutzen und Leonard Euler. Ein Bericht zur bevorstehenden Publikation des Briefwechsels in der Euler-Ausgabe
Erste Seite: 184
Letzte Seite: 189
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959871860.0.16
Verfasser*innen: Dieter Bauke
Titel des Beitrags: Mathematisches im Corpus der Goethezeichnungen
Erste Seite: 190
Letzte Seite: 207
Abstract
Goethes Beschäftigung mit mathematischen Fragestellungen oder der Mathematik finden wir nicht nur in seinen Texten. Auch in seinem zeichnerischen Werk finden wir, bisher fast unbeachtet, Beispiele für die Auseinandersetzung mit mathematischen Problemen (hier unter Ausschluss der Optik und vieler architektonischer Fragen). Einige Zeichnungen sind auch von Bekannten Goerthes, wie Riemer oder Werneburg, sie sind Diskussionsgrundlage zu mathematischen Fragestellungen. Insgesamt finden wir u. a. ein magisches Quadrat, verschiedenste geometrische Skizzen, Fünfeckkonstruktionen, architektonische Fragestellungen, Winkeldreiteilung und den Satz des Pythagoras, aber auch ein Barogramm, die Ebbe-Flut-Theorie nach Galilei, die mathematisch fundierte Darstellung geologischer Massen. Die Konstruktion von Ellipsen oder Spiralen ist durch Kreisbögen angenähert (Korbbogenkonstruktionen). Überraschend ist, dass Goethe die Kegelschnittherleitung (Schnitt eines Kreiskegels) kannte. Besonders interessant ist eine Skizze über die Verhältnisse von Umfang und Diameter bei Kreis und Quadrat. Nicht alle Skizzen können eindeutig identifiziert werden, hier ist weitere interdisziplinäre Forschung nötig.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959871860.0.17
Verfasser*innen: Philippe Séguin
Titel des Beitrags: Richard Dedekind 1888: Das Auflösevermögen des Arithmetikers
Erste Seite: 211
Letzte Seite: 222
Abstract
1888 veröffentlichte Dedekind Was sind und was sollen die Zahlen? (Zahlen), das gemeinhin von Mathematikern und Mathematikhistorikern zusammen mit Peanos Arithmetices Principia als der Grundstein zur Axiomatisierung der Arithmetik angesehen wird. Dabei wurde der für eine mathematische Schrift ungewöhnliche Titel entweder übersehen oder miss- bzw. umgedeutet. Interessanterweise lässt sich das an den unterschiedlichen Übersetzungen festmachen, zum Beispiel bei André Weil („Que sont et que représentent les nombres?“, also „Was sind und was stellen die Zahlen dar?“), dessen Übertragung dann vom Dedekind-Spezialisten Pierre Dugac übernommen wurde. Im folgenden Beitrag wird die Geschichte dieser Interpretationen rekonstruiert sowie nach Gründen gesucht, weshalb Dedekinds Vorwort unserer Ansicht nach unterschätzt wurde. Das führt uns zur These, dass Zahlen kein rein mathematisches Traktat war, sondern eine Kampfschrift, und dass sich Dedekind von seinem Abbildungsbegriff weit mehr erhoffte, als man vom rein mathematischen Standpunkt aus vermuten möchte.
Schlüsselwörter: Abbildung, axiomatische Methode, unendliche Mengen, Zahlbegriff, Dilthey, Helmholtz, Kronecker, Abbildungsvermögen, Einbildungskraft, Schöpferkraft, Weltanschauung.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959871860.0.18
Verfasser*innen: Peter Ullrich
Titel des Beitrags: Karl Schellbach (1804–1892) und seine Beiträge zu Mathematik, Lehrerbildung und Wissenschaftspolitik
Erste Seite: 223
Letzte Seite: 234
Abstract
Even though Karl Schellbach remained a high school teacher throughout his life, he left traces in mathematics, especially in the training of mathematics teachers and in science policy. Generally, he is known as teacher of Eisenstein, Hensel, and Prince Friedrich Wilhelm of Prussia, later Emperor Friedrich III, but above all as head of the “Mathematisch-pädagogische Seminar” in Berlin, which prominent mathematicians visited to prepare for school service.
Schellbach published numerous journal articles and books on mathematics, both on didactics and on research topics current at his times. From 1857 to 1880 he was co-editor of the “Journal für die reine und angewandte Mathematik” on the same level as Kronecker, Kummer, and Weierstrass. In the exercises from the “Mathematisch-pädagogische Seminar” one finds the method to determine local extrema without differential calculus which Schellbach had developed in order to circumvent the prohibition of infinitesimal calculus by the Prussian Ministry of Education in 1829. Generally, he campaigned against the repression of mathematics. In this regard, he acted as talented pedagogue and book author but was only able to influence the structures of the educational system to a limited extent.
However, Schellbach could use his relation to Prince Friedrich Wilhelm in order to promote mathematics and natural sciences. Memoranda to the Prince, in which Schellbach was involved, led to the establishment of the Astrophysical Observatory in Potsdam in 1874 and the “Physikalisch-technische Reichsanstalt” in 1883. Also the first foundation of a polytechnic school in Prussia, today’s RWTH Aachen, was influenced by him since it was initiated by the Prince. Schellbach also worked in the background when the “Königlich Technische Hochschule Charlottenburg” was founded in 1879, today’s TU Berlin.
Keywords
Karl Schellbach; training of mathematics teachers; determination of local extrema; polytechnic institute
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959871860.0.19
Verfasser*innen: Davidson Paulo Azevedo Oliveira
Titel des Beitrags: Zum mathematischen Unterricht in der Anfangsphase der ersten Bergbauhochschule Brasiliens
Erste Seite: 235
Letzte Seite: 245
Abstract
Die „Escola de Minas de Ouro Preto“ (EMOP) ist die erste Bergbauhochschule Brasiliens für Mineralogie und Geologie. Sie wurde im 19. Jahrhundert gegründet. Bisherige Studien über die EMOP, Pereira /Schubring [2014], Thiengo/Silva [2003], lassen erkennen, dass die Anfänge der Mathematik na dieser Institution ungenügend erforscht sind. Meine Dissertation soll dazu beitragen, dieses Desiderat zu beheben. Im vorliegenden Artikel wird der Frage nachgegangen, in welchem Maße Anfänge der Differentialrechnung in den Unterricht der EMOP einflossen. Die Arbeit basiert auf Quellen aus dem Permanent-Archiv der EMOP (Kursprogramme, Prüfungsaufgaben, u.a.) sowie dem Archiv des Kaiserlichen Museums von Petrópolis, wo sich die Korrespondenz des französichen Mineralogen und Geologen Henrique Gorceix (1842–1919), dem Gründungsdirektor der EMOP, mit dem brasilianischen Kaiser Dom Pedro II befindet. Wir konnten die Vermutung bestätigen, dass an der Bergbauhochschule EMOP ein hohes mathematisches Niveau bestand. Dies belegen die Aufgaben der analysierten Eingangs- und Abschlussprüfungen. Es erwies sich, dass die Prüfungskandidaten nicht nur das Rechnen beherrschten, sondern auch theoretisches Verständnis entwickelt hatten. Der Gründungsdirektor Gorceix realisierte einen engen Bezug zwischen Theorie und Praxis, worauf auch die Extremwertaufgaben deuten, die häufig im Examen zu lösen waren.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959871860.0.20
Verfasser*innen: Thomas Bedürftig
Titel des Beitrags: Fliegt der ruhende Pfeil?
Erste Seite: 249
Letzte Seite: 262
Abstract
Wir verfolgen den Pfeil auf seinem Flug durch die Geschichte der Philosophie und Mathematik. Beim Start und immer wieder gerät er in Gefahr, in ausgedachten Punkten zu ruhen, bis er in der heutigen mathematischen Welt von Punkten endgültig zur Ruhe zu kommen scheint.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959871860.0.21
Verfasser*innen: Karl Kuhlemann
Titel des Beitrags: Neue Blicke auf alte Infinitesimalien: Nichtstandard-Analysis und Leibniz‘ inassignable Größen
Erste Seite: 263
Letzte Seite: 273
Abstract
Die Pioniere der Analysis rechneten mit infinitesimalen Größen. Leibniz nennt diese Größen auch „unvergleichlich klein“ oder „unbestimmt klein“ oder „inassignabel“ (nicht zuweisbar, nicht angebbar). An anderer Stelle erklärt er infinitesimal mit „kleiner als jede gegebene Größe“. Je nach Auslegung der verschiedenen Umschreibungen wird Leibniz als Wegbereiter sowohl für die heutige Standardanalysis als auch für die heutige Nichtstandard-Analysis in Anspruch genommen. In diesem Aufsatz wird dargelegt, wie die „Zweisortigkeit“ der Leibniz’schen Größen (assignabel/inassignabel) in einer Nichtstandard-Analysis durch Spracherweiterung verstanden werden kann. Hierdurch wird eine echte Infinitesimalrechnung innerhalb der reellen Zahlen möglich. Theoretische Grundlage hierfür ist die Interne Mengenlehre von Edward Nelson.
Keywords: Leibniz, assignabel, inassignabel, infinitesimal, Nichtstandard-Analysis, Interne Mengenlehre, Edward Nelson
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959871860.0.22
Verfasser*innen: Renate Tobies
Titel des Beitrags: Felix Klein und Paul Koebe – „Durchführung eines im Grunde doch Kleinen Programms“
Erste Seite: 274
Letzte Seite: 291
Abstract
This article analyzes the relationship between the mathematicians Felix Klein and Paul Koebe. Inspired by Klein, Koebe provided the proofs for the uniformization theorems formulated by Klein and Henri Poincaré. In particular, Koebe was able to realize Klein’s original idea of a continuity proof, the possibility of which had been doubted by Poincaré. By analyzing Koebe’s letters to Klein and files from the Jena University Archives, new insights could be gained, which also concern Paul Koebe’s biography.
Dieser Artikel analysiert die Beziehung zwischen den Mathematikern Felix Klein und Paul Koebe. Inspiriert von Klein lieferte Koebe die Beweise für die von Klein und Henri Poincaré formulierten Uniformisierungstheoreme. Insbesondere war Koebe in der Lage, Kleins ursprüngliche Idee eines Kontinuitätsbeweises zu realisieren, dessen Möglichkeit von Poincaré bezweifelt worden war. Durch die Analyse von Koebes Briefen an Klein und von Akten aus dem Jenaer Universitätsarchiv konnten neue Erkenntnisse gewonnen werden, die auch die Biographie Paul Koebes betreffen.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959871860.0.23
Verfasser*innen: Rita Meyer-Spasche
Titel des Beitrags: Zur Geschichte der finiten Differenzen
Erste Seite: 292
Letzte Seite: 304
Abstract
Since the time of the Romans finite differences were used to simplify computations in many ways; after the 17th century for instance for localizing zeroes of functions, approximating definite integrals or producing numerical tables. Up to 1900 they were used very rarely for solving differential equations numerically. After 1900, when the importance of differential equations grew dramatically, finite differences became one of the main tools for solving them. This article focusses on the state of knowledge and skills about the theory of finite differences on the eve of this change. It relies strongly on the article by D. Selivanov in the encyclopaedia because it provides the needed overview.
Keywords:
calculus of finite differences; state of knowledge around 1900; Demetrius Seliwanoff; encyclopaedia of the mathematical sciences and their applications, vol 1 (1904);
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959871860.0.24
Verfasser*innen: Hannelore Bernhardt
Titel des Beitrags: Notizen zur Geschichte der Mathematik in der NTM der Jahre 1960–1990
Erste Seite: 305
Letzte Seite: 315
Abstract
Die „Zeitschrift für Geschichte der Naturwissenschaften, Technik und Medizin“ (NTM) wurde im Jahre 1960 von dem Physiker und Wissenschaftshistoriker Gerhard Harig (Leipzig) und dem Mediziner und Medizinhistoriker Alexander Mette (Berlin) mit dem Ziel gegründet, die Wissenschaftsgeschichte als selbständige Wissenschaftsdisziplin mit eigenständigen Problemstellungen und Begrifflichkeiten einem breiten Kreis von Interessenten bekannt zu machen und zugleich zu einem tieferen Verständnis für die Gesetzmäßigkeiten in der Entwicklung von Natur und Gesellschaft und ihren Wechselwirkungen beizutragen.
Im ersten Teil des Beitrages wird die wechselvolle Geschichte der NTM selbst beleuchtet, die heute konzeptionell auf eine Erweiterung ihrer Inhalte auf „Internationalität und Offenheit für unterschiedliche geistige Orientierungen“ ausgerichtet ist. Der zweite Teil ist spezieller den vielfältigen Frage- und Problemstellungen der Entwicklung der Mathematik und ihrer Anwendungen in Arbeiten unterschiedlichen Umfangs sowie Rezensionen, Tagungsberichten, Biographien, Nekrologen u. a. im Zeitraum zwischen 1960 und 1990 gewidmet. Beiträge zur Geschichte der Algebra lassen dabei ein markantes Forschungsfeld erkennen.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959871860.0.25
Verfasser*innen: Waltraud Voss
Titel des Beitrags: Der Mathematiker Gerhard Kowalewski – in der NS-Zeit angepaßt, aber auch Opfer
Erste Seite: 316
Letzte Seite: 327
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959871860.0.26
Verfasser*innen: Ysette Weiss
Titel des Beitrags: Geschichte des Mathematikunterrichts in der universitären Lehrerbildung
Erste Seite: 328
Letzte Seite: 339
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959871860.0.27
Verfasserin: Annette Vogt
Titel des Beitrags: E.J.Gumbel — Mathematiker und politischer Publizist
Erste Seite: 340
Letzte Seite: 351
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959871860.0.28
Abstract
Emil Julius Gumbel (1891-1966) – Mathematiker und politischer Publizist
Der Mathematiker und Statistiker E. J. Gumbel arbeitete seit seiner Vertreibung 1932/33 im Exil besonders zur Extremwertstatistik, sein Hauptwerk „Statistics of Extremes“ erschien 1958 in New York (eine Reprint-Ausgabe 2013). Aber er war auch ein politischer Aktivist und Pazifist, Redner und Autor politischer Bücher und Artikel, darunter in der damals berühmten Wochenschrift „Die Weltbühne“. Er wirkte als Mathematiker und Statistiker ab 1923 an der Universität Heidelberg und als politischer Autor. Auch im Exil in Frankreich behielt er diese Arbeitsweise bei, er verfasste mathematische Arbeiten und publizierte Artikel gegen das NS-Regime in Exil-Zeitschriften.
Der Beitrag skizziert die Erinnerungen an Gumbel – Nachrufe und Publikationen – sowie die Rezeptionsgeschichte. Sie war bis 2019 zweigeteilt – es erschienen Artikel und Bücher zu Gumbel als Mathematiker oder zu Gumbel als Publizist und Autor politischer Bücher. Die „Wiederentdeckung“ des „politischen Gumbel“ begann im Jahr 2012 und fast zeitgleich auch die „Wiederentdeckung“ des „mathematischen Gumbel“. Die Anwendungen der „Gumbel Distribution“ und der Gumbel-Copula zur Modellierung stochastischer Abhängigkeiten weckten das Interesse an der Person Gumbel und seinen Leistungen. Die unterschiedliche Rezeptionsgeschichte und neue Forschungsergebnisse zu E. J. Gumbel werden vorgestellt.
Verfasser*innen: Holger Wuschke
Titel des Beitrags: Entwickung der Stundentafeln und Lehrpläne von 1945-1962 in der SBZ und frühen DDR
Abstract
Eine Veränderung der Stundentafeln birgt eine notwendige Veränderung der Lehrpläne in sich. Bleibt die Stundentafel unverändert, müssten auch die Lehrpläne in ihrem Umfang gleichbleiben, wobei inhaltliche Veränderungen möglich sind. So die These, welche im Beitrag untersucht werden soll. Dazu wird einerseits die Entwicklung der Stundentafeln dargestellt und andererseits ansatzweise betrachtet, welche Aussagen in Bezug auf die Lehrplanentwicklung getroffen werden können.
Keywords
SBZ, DDR, Mathematikunterricht, Stundentafel, Lehrplan, Lehrpläne, Direktive, SMAD, MfV, DVV, Volk und Wissen
Erste Seite: 352
Letzte Seite: 363
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959871860.0.29