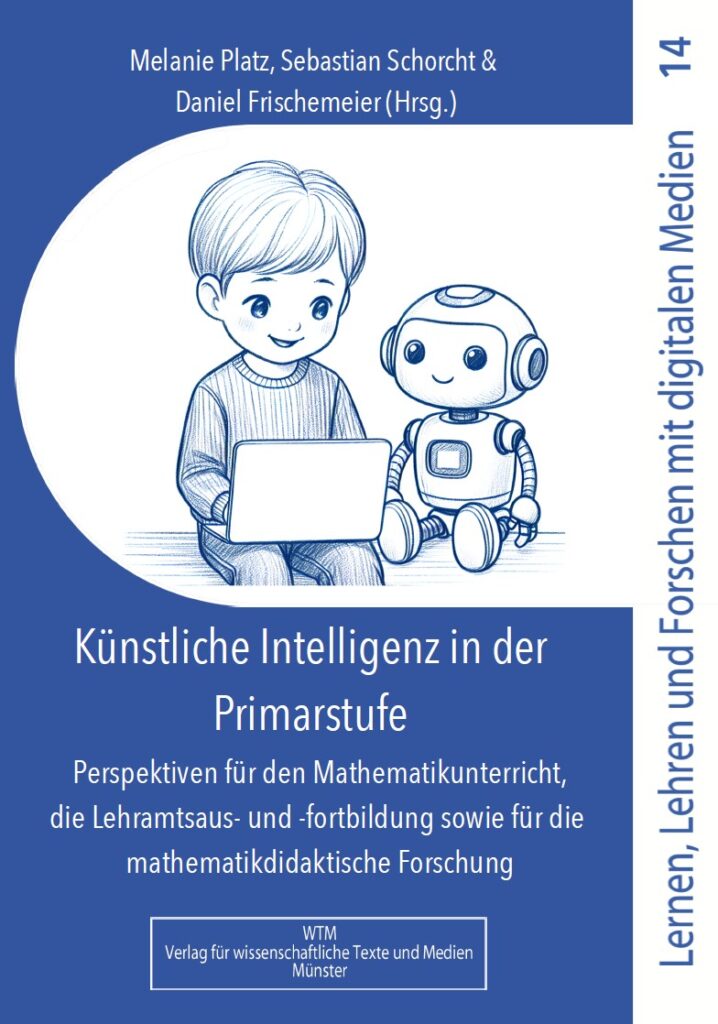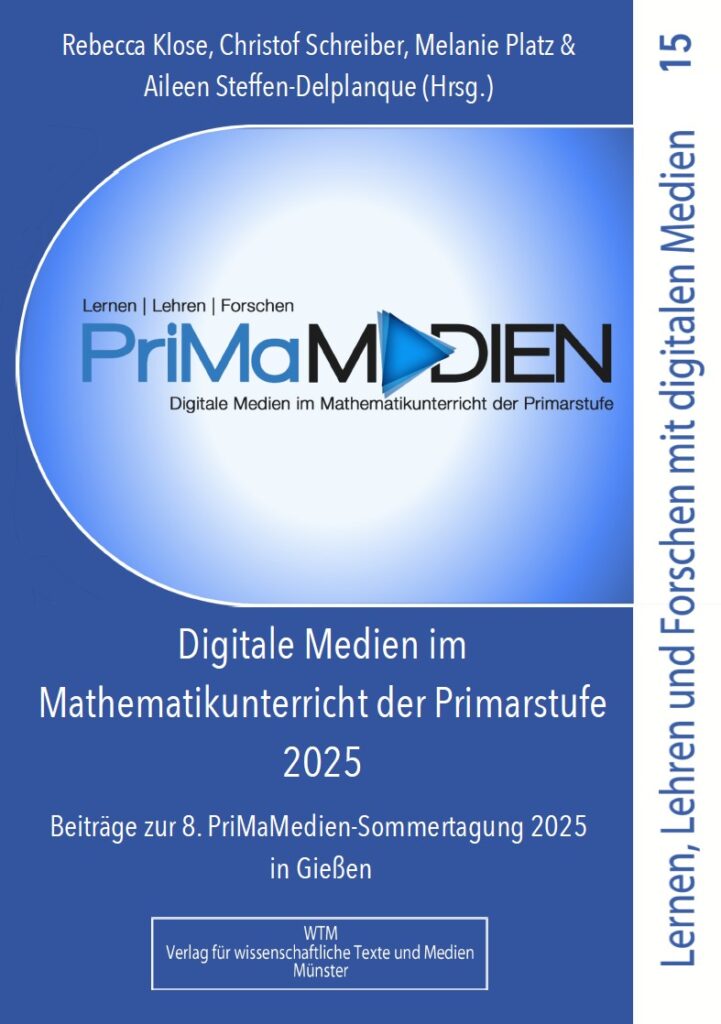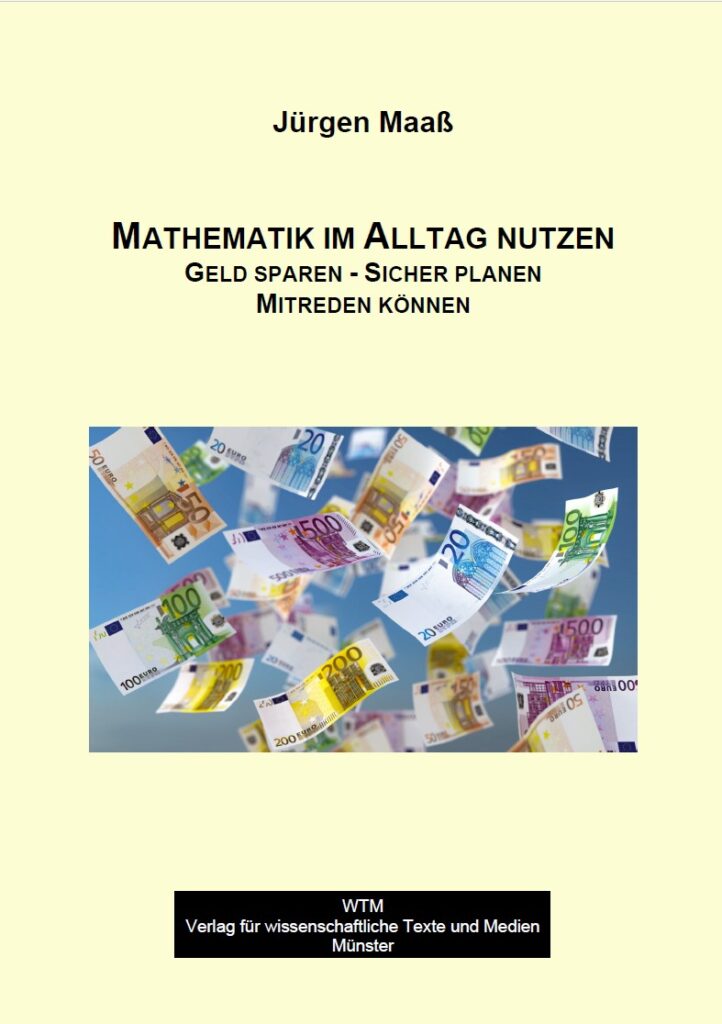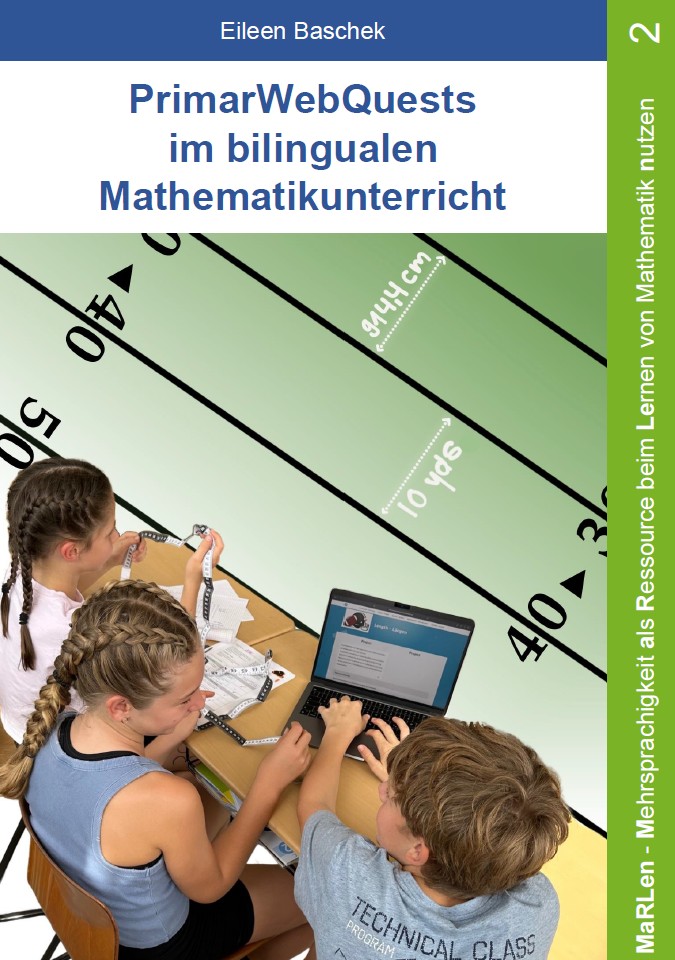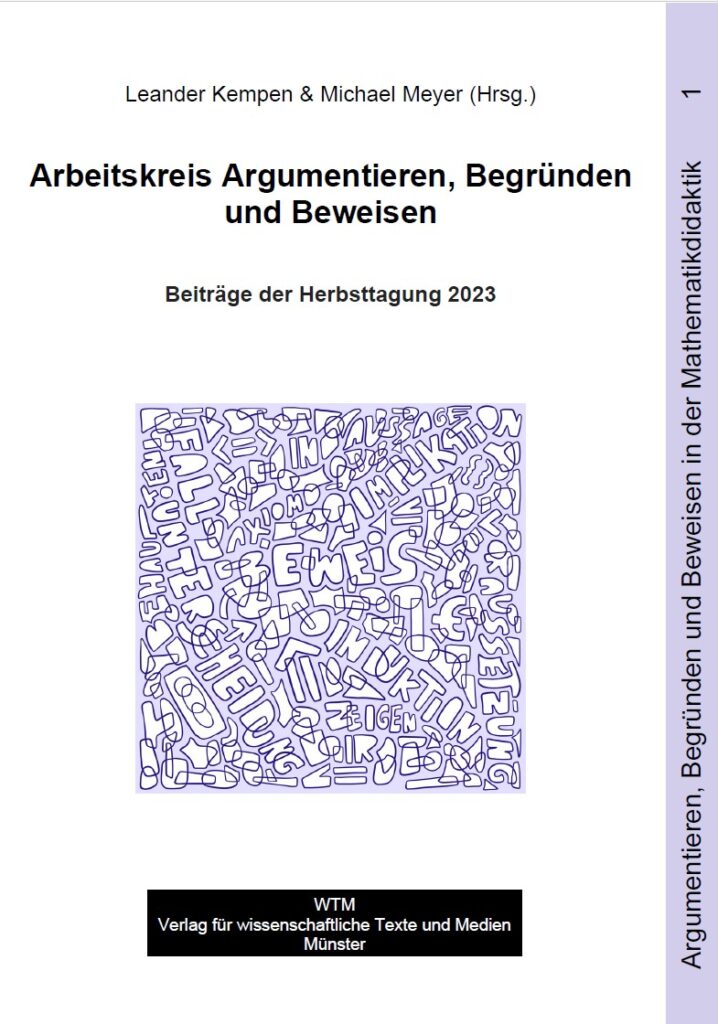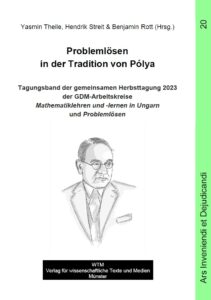 Tagungsband der gemeinsamen Herbsttagung 2023 der GDM-Arbeitskreise Mathematiklehren und -lernen in Ungarn und Problemlösen
Tagungsband der gemeinsamen Herbsttagung 2023 der GDM-Arbeitskreise Mathematiklehren und -lernen in Ungarn und Problemlösen
Band 20 der Reihe Ars inveniendi et dejudicandi
Münster: WTM-Verlag 2024
Ca. 190 Seiten, DIN A5
978-3-95987-325-3 Print 29,90 €
978-3-95987-326-0 E-Book 27,90 €
https://doi.org/10.37626/GA9783959873260.0
Das Buch können Sie hier kaufen.
Abstract
„Problemlösen“ und „Pólya“ – das sind zweifellos untrennbare Stichworte. Dass die neunte Herbsttagung des GDM-Arbeitskreises Problemlösen gemeinsam mit dem GDM-Arbeitskreis Mathematik lehren und lernen in Ungarn in George Pólyas Geburtsstadt Budapest stattfand, erscheint vor diesem Hintergrund umso passender. Ein Hauptvortrag von Péter Juhász zur Talententdeckung und Talentförderung in Ungarn, 19 Kurzvorträge, eine Postersession, ein gemeinsames Konferenzdinner sowie anregende Gespräche boten den Teilnehmenden viele Gelegenheiten zum Austausch, Diskutieren und Vernetzen. Dabei war das Motto der Tagung „Problemlösen in der Mathematik: Impulse aus der ungarischen Tradition“ stets präsent. In dem vorliegenden Tagungsband werden einige der vielfältigen und anregenden Beiträge der Teilnehmenden aufgegriffen.
BEITRÄGE
=====================================================
András Ambrus: Mathematikdidaktische Theorie der Lehrpraxis näherbringen
Abstract
Die Kluft zwischen der Praxis und Theorie des Mathematikunterrichts ist beachtlich. Aus diesem Grund beschreibe ich in meinem Artikel am Beispiel eines konkreten ungarischen Falls, wie man mit praktizierenden Lehrer:innen zusammenarbeiten und – basierend auf der mathematikdidaktischen Forschung – praxistaugliche Lösungen für ihre konkreten Unterrichtsprobleme geben kann.
Erste Seite: 3
Letzte Seite: 12
=====================================================
Gabriella Ambrus: Worum geht es eigentlich in den Texten der Textaufgaben in den Schulbüchern?
Abstract
Die Grundsituation einer Textaufgabe sowie ihre Beschreibung in der Aufgabe, ihr Bezug zur Realität und zum Alltag können vielfältig sein. Es lohnt sich, über das Wesen dieser Beziehungen und ihre didaktischen Implikationen nachzudenken. Beispielsweise, ob die Textaufgaben, die wir auf ersten Blick als „Typenaufgabe“ bezeichnen würden, wirklich immer solche sind, oder darüber, welche didaktische Bedeutung eine geeignete „Einkleidung“ eines mathematischen Inhalts in einer Textaufgabe im Unterricht haben kann.
Im Mittelpunkt des Beitrags stehen die genannten (Grund)situationen und Formulierungen beziehungsweise Fragestellungen von Textaufgaben, die mehr oder weniger realitätsnah sind. Anhand der vorhandenen „Realitätsnähe“ in der Situation beziehungsweise in der Fragestellung lassen sich die Textaufgaben in mehrere Kategorien einordnen. Neben der Analyse dieser Kategorien wird auch – mittels dreier bekannter ungarischer Lehrbuchreihen – auf das Vorliegen der erwähnten Textaufgaben-Kategorien in diesen Lehrbüchern am Beispiel der Lehre der direkten Proportionalität eingegangen. Schließlich werden die so erhaltenen Ergebnisse diskutiert.
Erste Seite: 13
Letzte Seite: 25
=====================================================
Sabine Apfler & Lukas Prenner: Problemlösendes Denken in der Grundschule in Österreich mit digi.case
Abstract
Problemlösendes Denken rückte durch die Einführung der Bildungsstandards und Kompetenzorientierung in Österreich vermehrt in den Fokus, da Problemlösen als Kompetenzbereich in Mathematik definiert wurde. Problemlösendes Denken zeigt sich auch als Bestandteil von informatischem Denken, besonders im Bereich algorithmischen Denkens. 2017 wurde in Österreich das Projekt „Denken lernen, Probleme lösen“ mit dem Ziel gestartet, Schüler:innen bereits in der Volksschule einen Zugang zu informatischem Denken zu ermöglichen. In der zweiten Projektphase, die im Herbst 2023 flächendeckend startete, liegt der Fokus auf Problemlöse-denken. Den Schulen wird ein Materialkoffer, der digi.case, zur Verfügung gestellt, mit dem Problemlösekompetenzen und informatisches Denken von Schüler:innen durch die Verwendung haptischer Materialien gefördert werden sollen. In diesem Beitrag werden die Verbindung von Problemlösedenken und informatischem Denken erarbeitet und das Projekt „Denken lernen, Probleme lösen (DLPL) mit digi.case“ vorgestellt.
Erste Seite: 27
Letzte Seite: 40
=====================================================
Ágota Figula & Emese Kása: Die Untersuchung der reflektiven Abstraktion und der Gruppenarbeit beim Thema „Logarithmische Gleichungen“
Abstract
In unserer Forschung haben wir die Schüler:innen einer 11. Klasse, die die Mathematik auf höherem Niveau gelernt haben, zum Thema der logarithmischen Gleichungen untersucht. Unser Ziel war es, ihre reflektiven Abstraktionsfähigkeiten nach den Stufen von Cifarelli zu ermitteln, und zu beobachten, wie sie, die verschiedene Abstraktionsstufen beherrschen, in der Gruppenarbeit mit ihren Partnern kommunizieren können. Außerdem haben wir unter die Lupe genommen, auf welche Weise die Schüler:innen von dem Experiment profitieren. Es ist ein wichtiges Thema, weil wir dadurch die Entwicklung der Denkweise der Schüler:innen und die positiven Wirkungen der Gruppenarbeit untersuchen konnten. Die Leistung der Schüler:innen wurde durch Leistungskontrollen gemessen, und wir haben auch ihre Aktivität und Bemerkungen während der Stunden beobachtet. Mithilfe dieser Methoden konnten wir eine gute Einstufung des Kenntnisstandes der Schüler:innen vornehmen. Nach der Gruppenarbeit haben sich die Aktivität und das Verhalten beim Mathematiklernen von mehreren Schüler:innen entwickelt, deswegen konnten sie auf ihre Tätigkeit effektiver reflektieren und dadurch in eine höhere Kategorie geraten. Wir denken, dass es sich lohnt, Schüler:innen mit verschiedenen Kenntnisständen gemeinsam arbeiten zu lassen. Außerdem können wir die Entwicklung unserer Schüler:innen besser folgen, wenn wir eine entsprechende Einstufung benutzen.
Erste Seite: 41
Letzte Seite: 58
=====================================================
Zsolt Fülöp: Principal aspects of the transition from arithmetic to algebra – an analysis of Hungarian lower secondary school mathematics textbooks
Abstract
Our main aim is to investigate the content of the Hungarian mathematics textbooks regarding the transition from arithmetic to algebra in lower secondary school education. The quality of a textbook may influence teaching activities and contribute to how pupils learn subjects. Textbooks are also useful tools for implementing curricula. Many research studies have shown that students encounter difficulties in the transition from arithmetic to algebra. It is also well-known that understanding the structural aspect of algebra is more difficult for pupils than the procedural aspect. Certain conceptual and symbolic changes mark a difference between arithmetic and algebraic thought in the individual, such as the different interpretation of letters and the notion of equality. In order to study arithmetic it is very sufficient to adopt a computational or procedural way of thinking. Pupil’s difficulties with the algebraic structure are due to their lack of understanding of structural notions in arithmetic. Therefore in order to succeed in algebra, pupils have to break away from arithmetical conventions and to adopt an algebraic way of thinking. Shortly, the transition from arithmetic to algebra means the transition from procedural thinking to structural thinking. In our study, we investigated the tasks and exercises in the textbooks with particular regard to the following: quantitative reasoning, generalizing arithmetical operations, functional relationships between variables, letter symbolic representations, translation of word problems into algebraic equations.
Erste Seite: 59
Letzte Seite: 73
=====================================================
Deng-Xin Ken Oehler & Matthias Ludwig: Entwicklung eines interdisziplinären Kodierungsmanuals zur Charakterisierung mathematischer und informatischer Problemlöseprozesse
Abstract
Die mathedidaktische Problemlöseforschung hat lange Tradition – bereits so lange und von intensiver Forschung begleitet, dass sich die wesentlich jüngere Disziplin der Informatikdidaktik zumeist mathematisch erprobter Problemlösemodelle bedient. Allen voran ist hier George Polyas Vier-Phasen-Modell zu nennen. Allerdings findet die Nutzung dieses fachfremden Modells bislang ohne theoretische und empirische Legitimation statt. Ebendiese Legitimation soll durch die Entwicklung eines interdisziplinären Problemlösemodels aufgebaut werden, welches zunächst deduktiv von einem Polya-verwandten, mathematischen Modell hergeleitet und anschließend induktiv für informatische Problemlöseprozesse erweitert wird. Dieser Beitrag beschreibt den bisherigen Entwicklungsprozess des zugrunde liegenden Manuals zur Kodierung von Problemlöseprozessen beider Disziplinen anhand erster Ergebnisse einer Pilotstudie. Diese werden abschließend zur Ableitung von Implikationen für weitere Verbesserungen des Manuals kritisch beleuchtet.
Erste Seite: 75
Letzte Seite: 92
=====================================================
Lilli Schonebeck & Thomas Gawlick: Zu einem Erfolgsmaß bei der Aufgabe, die Winkelsumme des Sternfünfecks zu bestimmen
Abstract
Paaren aus Lehramtsstudierenden wurde die Aufgabe P1 gestellt, die Innenwinkelsumme in einem Sternfünfeck zu bestimmen. Um den Zusammenhang von Erfolg und Heurismennutzung einer Dyade zu untersuchen, wird das Konstrukt Problemlöseerfolg aufgabenbezogen elaboriert und operationalisiert. Anhand von paradigmatischen Prozessen wird gezeigt, dass es möglich ist, Lösungsweg-unabhängige Wegmarken zu definieren, die zur Lösung von P1 zu passieren sind. Um zu berücksichtigen, inwieweit der Erfolg eines Paares durch problemlösendes Denken entstand, wird der Bearbeitungserfolg pro Wegmarke mit der Schwierigkeitsstufe des (beobachteten oder erwarteten) Denkprozesses zu ihrer Erreichung gewichtet.
Erste Seite: 93
Letzte Seite: 116
=====================================================
Hannah Schlich & Thomas Gawlick: Problemlösetypen bei der Aufgabe, die Winkelsumme des Sternfünfecks zu bestimmen
Abstract
Wir videographierten 8 Bearbeitungsprozesse von Lehramtsstudierenden der o.a. Aufgabe. In der Rückschau deutliche Gemeinsamkeiten der Prozesse gaben Anlass, die Prozesse von 5 der Paare zu Typen zu gruppieren, deren Wechselverhalten in spezifischer Weise unangemessen ist. In diesem Beitrag werden diese intuitiv gebildeten Typen zunächst inhaltsanalytisch ausgeschärft, woraus die prägnanten Bezeichnungen zweifelnd, planlos bzw. engstirnig resultieren. Diese betten wir dann in ein deduktives zweiachsiges Kategoriensystem ein – und in dem findet sich dann auch ein Kategorienpaar, das zwei untypisierte Prozesse charakterisiert: als zielstrebig. Die Typisierung wird schließlich durch quantitative Kenngrößen abgesichert (oder revidiert), die auch eine Perspektive eröffnen, die Typen für die Praxis nutzbar zu machen.
Erste Seite: 117
Letzte Seite: 135
=====================================================
Johann Sjuts: Problemlösen in Mathematik bis zum Ende der Grundschule – mathematisch konstitutiv, biographisch anschlussfähig und technologisch zukunftsorientiert?!
Abstract
Die Agenda qualitätssichernder Maßnahmen des vorschulischen und schulischen Lehrens und Lernens von Mathematik ist dauerhaft seit vielen Jahren und aktuell mit steigender Dringlichkeit geprägt durch eine Reihe didaktischer, methodischer und pädagogischer Erfordernisse. Dazu gehört, wesenscharakteristische Ansprüche des mathematischen Denkens kontinuierlich über die gesamte Bildungsbiographie unter Einbezug technologischer Entwicklungen zur Geltung zu bringen – insbesondere zum mathematischen Problemlösen.
- Im Mathematikunterricht sind sowohl konstitutive Sachgebiete der Mathematik als auch zentrale inhaltsübergreifende Wesenszüge durchgängig von Bedeutung. Problemlösen leistet dazu einen essentiellen Beitrag. Grundlegend und wesensbestimmend beim Problemlösen ist die Klärung der Fragen, ob es überhaupt eine Lösung bzw. ob es mehrere Lösungen gibt.
- Alle curricularen Phasen schulischer Bildungsgänge haben anschlussfähige Übergänge sicherzustellen. Das ist eine Vorgabe der Bildungsstandards. In ihrer persönlichen Lebensgeschichte erleben indes allzu viele Menschen hinsichtlich Mathematik markante biographische Brüche und Abbrüche. Es gilt, wiederkehrenden Diskontinuitäten entgegenzuwirken.
- Neue Technologien bestimmen ganz maßgeblich Lebens- und Lernwirklichkeiten. Dies ist derzeit von hoher Relevanz beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) und insbesondere von generativen KI-Chatbots. Zu fragen ist, inwieweit der Einsatz eines Chatbots für das Lehren und Lernen von mathematischem Problemlösen einen Nutzen erbringen kann.
Im Mittelpunkt der hier präsentierten experimentellen Studie stehen Aufgaben zum mathematischen Problemlösen.
Erste Seite: 137
Letzte Seite: 154
=====================================================
Hendrik Streit & Benjamin Rott: Fehlerklima und Problemlösen im Mathematikunterricht – Entwurf eines Forschungsprojekts
Abstract
In der Forschungsliteratur zum Problemlösen im Mathematikunterricht werden regelmäßig Vorschläge, Anregungen oder Hinweise zum Lehren von Problemlösen formuliert. Eine der genannten Herangehensweisen ist die Orientierung an und das produktive Nutzen von Fehlern, wobei besonders ein positives Fehlerklima als wichtiges Merkmal des Unterrichts erscheint. Der Begriff bzw. das Konstrukt Fehlerklima findet jedoch nur selten Erwähnung in der Literatur zum mathematischen Problemlösen, obwohl es sich dabei im Kern um etwas zu handeln scheint, das wiederholt gefordert wird: eine problemlösefreundliche Atmosphäre. Mehr noch: Eine Analyse des achtdimensionalen Fehlerklimamodells von Steuer (2014) zeigt, dass Merkmale eines positiven Fehlerklimas zugleich für einen gelungenen problemorientierten Mathematikunterricht sprechen könnten. Im vorliegenden Beitrag wird diese Vermutung methodisch fundiert untersucht. Erste strukturierte Erkundungen des Forschungsgegenstands unterstreichen, dass es einige Aspekte gibt, die sowohl für ein positives Fehlerklima als auch für einen gelungenen problemorientierten Mathematikunterricht charakteristisch sind.
Erste Seite: 155
Letzte Seite: 168
=====================================================
Yasmin Theile & Benjamin Rott: Schülerfehler im problemorientierten Unterricht: Identifikation von Umgangsformen bei Grundschullehrkräften
Abstract
Bislang ist nur wenig über den Umgang von Lehrkräften mit Schülerfehlern im problemorientierten Unterricht bekannt – für den Bereich der Primarstufe existieren dazu bis heute keinerlei Erkenntnisse. In diesem Beitrag stellen wir daher erste Studienergebnisse zum Umgang mit Schülerfehlern bei Grundschullehrkräften vor. Es wurden fünf Unterrichtsstunden, bei denen die Schüler:innen problemhaltige Aufgaben lösen sollten, von Lehrkräften aus verschiedenen Grundschulen aus Nordrhein-Westfalen videografiert. Der Schwerpunkt der Auswertung lag darauf, wie die Lehrkräfte auf die Schülerfehler reagierten. Der aus den Auswertungen resultierende Kriterienkatalog inklusive der 14 identifizierten Umgangsformen wird im Beitrag detailliert erläutert.
Erste Seite: 169
Letzte Seite: 184